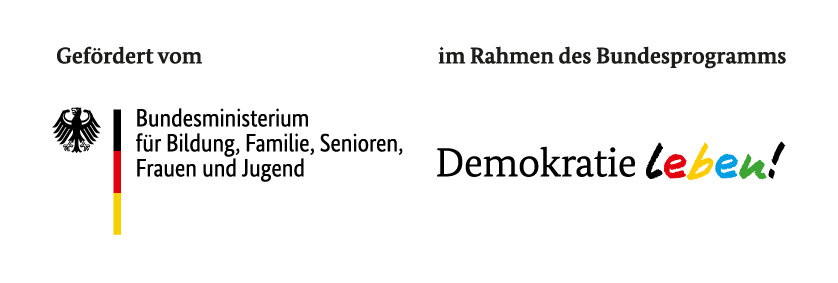Methodik
Im ersten Projektabschnitt werden Schulen ausgewählt, die mit ihren Klassen an dem Projekt teilnehmen wollen. Diese Zusammenarbeit inkludiert nicht nur die Datenerhebung, sondern auch die Durchführung von Argumentationstrainings, sowie eine thematische Begleitung mittels Workshops. Bei Interesse an einer Zusammenarbeit wenden Sie sich bitte an projekt.medienkompetenz(at)hfjs.eu.
Zur Datenerhebung kombinieren die Forschenden zwei methodische Ansätze, um die Verbreitung und Wirkung extremistischer Narrative im Kontext des Nahostkonflikts qualitativ zu untersuchen:
Medientagebuch:
Teilnehmende führen über mehrere Wochen ein digitales Medientagebuch, hinsichtlich ihres Social-Media Konsums. Bei dieser empirischen Forschungsmethode wird täglich, systematisch der Medienkonsum dokumentiert und reflektiert. Den Jugendlichen und jungen Erwachsenen werden dabei zu Beginn einmalig biographische Fragen, sowie Fragen zur Nutzung von sozialen Medien und zum Konsum verschiedener Themen gestellt. Anschließend werden täglich Fragen zu den rezipierten Inhalten abgefragt. Dabei sollen Narrative und extreme Inhalte zum Nahostkonflikt festgehalten und bewertet werden.
Interviews:
Mit jungen Erwachsenen ab 16 Jahren werden Interviews geführt, um das Radikalisierungspotential sowie die Bedeutung des Nahostkonflikts für die Identitätskonstruktion zu erfassen. Um sowohl biographische Entwicklungen zu berücksichtigen, als auch die Messbarkeit der Ergebnisse sicherzustellen, kombiniert das Interview biographisch-narrative und leitfadengestützte Elemente. Außerdem wird in den Interviews Teilnehmenden des Medientagebuchs eine kritische Reflexion zu ihrem Medienkonsum ermöglicht. Zusätzlich soll beleuchtet werden, ob und wie Jugendliche (links-) extremistische Inhalte im Bezug auf den Nahostkonflikt erkennen und wie Diese ihren Lebensalltag prägen.
Basierend auf diesen Erhebungen sollen anschließend im zweiten Teil des Projekts Argumentationstrainings und Workshops entwickelt werden.